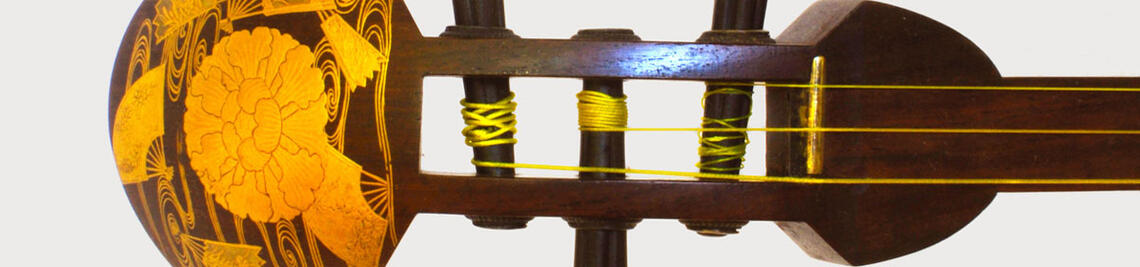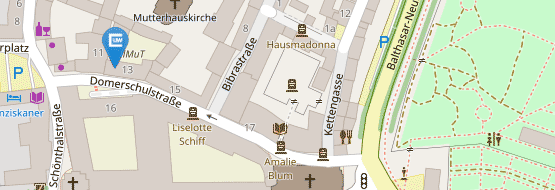Lesenswertes zum Ohr
Kapellmeister Lockmann zum Körperhören (1794)
"Meßbar und erklärbar wirken die Töne an und für sich durch ihre Höhe und Tiefe, Stärke und Schwäche; und dann durch ihre Dauer, Folge und Verbindung. Man könnte dieß die reine Musik nennen. Sie greift die Nerven und alle Theile des Gehörs an, und verändert dadurch das innre Gefühl außer allen andern Vorstellungen das Phantasie. Schon das Wasser pflanzt den Schall mehr als doppet stärker und weiter fort, als die Luft; noch besser die festen Theile unsers Körpers. Der ganze Mensch erklingt gleichsam, und es entstehen Empfindungen nach dem Verhältnisse der Töne und der Beschaffenheit der Massen, wodurch sie hervorgebracht werden.
Unser Gefühl selbst ist nichts anders, als eine innre Musik, immerwährende Schwingung der Lebensnerven. Alles, was uns umgiebt, was wir Neues denken und empfinden, vermehrt oder vermindert, verstärkt oder schwächt den Grad ihrer vorigen Bewegung. Die Musik rührt sie so, daß es ein eigenes Spiel, eine ganz besondre Mittheilung ist, die alle Beschreibungen von Worten übersteigt. Sie stellt das innre Gefühl von außen in der Luft dar, und drückt aus, was aller Sprache vorhergeht, sie begleitet, oder ihr folgt."
Wilhelm Heinse, Hildegard von Hohenthal, unter Mitarb. von Bettina Petersen hrsg. und kommentiert von Werner Keil, Hildesheim etc. (Olms) 2002, S. 22.

Die Fackel im Ohr von Elias Canetti: Schule des Hörens
"(...) Das Erbteil an Intoleranz, das ich mitbekommen hatte, wurde ich auch hier nicht los. Doch ich lernte den intimen Umgang mit einem denkenden Menschen, wobei es darauf ankommt, dass man jedes Wort nicht nur hört, sondern auch zu begreifen versucht und dieses Begreifen bezeugt, indem man genau und ohne Verzerrung entgegnet. Die Achtung vor Menschen beginnt damit, dass man sich nicht über ihre Worte hinwegsetzt. Ich möchte es die stille Lehre dieser Zeit nennen, obwohl sie sich in so viel Worten abspielte, denn die andere, ihr entgegengesetzte Lehre, in die ich zugleich ging, war laut und eklatant.
Dass man mit den Worten anderer alles machen kann, erfuhr ich von Karl Kraus. Er operierte mit dem, was er las, auf atemberaubende Weise. Er war ein Meister darin, Menschen in ihren eigenen Worten zu verklagen. Das bedeutete nicht, dass er ihnen dann seine Anklage in seinen ausdrücklichen Worte ersparte. Er lieferte beides und erdrückte jeden. Man genoß das Schauspiel, weil man das Gesetz anerkannte, von dem diese Worte diktiert waren; aber auch weil man mit vielen anderen zusammen war und die ungeheuerliche Resonanz empfand, die sich Masse nennt, wo man sich an seinen eigenen Grenzen nicht mehr wund reibt. Keines dieser Erlebnisse mochte man missen, keines von ihnen ließ man sich je entgehen. In diese Vorlesungen ging man auch krank und mit hohem Fieber. Man frönte damit auch dem Hang zur Intoleranz, der von Haus aus stark war und sich nun sozusagen legitim auf beinahe unvorstellbare Weise steigerte.
Viel wichtiger war, dass man gleichzeitig das Hören erlernte. Alles, was gesprochen wurde, überall, jederzeit, von wem immer, bot sich zum Hören an, eine Dimension der Welt, von der man bis dahin nichts geahnt hatte, und da es um die Verbindung von Sprache und Menschen ging, in all ihren Varianten, war es vielleicht die bedeutendste, jedenfalls die reichste. Diese Art des Hörens war nicht möglich ohne Verzicht auf eigene Regungen. Sobald man in Gang gebracht hatte, was sich hören ließ, trat man zurück und nahm nur noch auf und durfte sich darin durch kein Urteil, keine Empörung, kein Entzücken hindern lassen. Wichtig daran war die unverfälschte, reine Gestalt, dass sich keine dieser akustischen Masken (wie ich sie später nannte) mit der anderen vermischte. Lange war man sich der Größe des Vorrats, den man sammelte, gar nicht bewusst. Man empfand nur eine Gier nach Redeweisen, die man sich sauber und abgegrenzt wünschte, die man wie einen Gegenstand in die Hand nehmen konnte, die einem plötzlich, ohne dass man ihren Zusammenhang mit etwas erkannte, einfilen, so dass man sie sich laut vorsagen musste; nicht ohne Staunen über ihre Rundgeschliffenheit und die sichere Blindheit, mit der sie alles andere ausschlossen, was es sonst auf der Welt zu sagen gab, das allermeiste, alles, denn ihnen selbst blieb eine einzige Eigenschaft: dass sie sich immer und immer wiederholen mussten.
Ein Bedürfnis nach solchen Masken, ihre Selbständigkeit sozusagen, unabhängig von denen, die ich aus den ?Letzten Tagen der Menschheit? von Karl Kraus zu hören bekam und nun auch schon auswendig kannte, empfand ich, glaube ich, in St. Agatha zum erstenmal, im Sommer 1926, als ich den Schwalben Stunden um Stunden zusah, ihrer raschen, leichten Bewegung und die immergleichen Laute hörte, die sie dabei von sich gaben. Diese Laute ermüdeten mich trotz ihrer Wiederholung nie, so wenig wie die wunderbaren Regungen ihres Flugs. Vielleicht hätte ich sie später, vergessen, aber dann kam die Kirchweih mit dem Hemdenverkäufer unter meinem Fenster und sein immergleicher Ausruf: "Heut is mir alles eins, ob i a Geld hab oder a keins!" Ausrufer hatte ich als Kind schon gern gehört und mir gewünscht, dass sie in der Nähe blieben und nicht so bald weitergingen. Dieser hier blieb, während zwei Tagen, an derselben Stelle, unverrückbar unter meinem Fenster. Wenn ich aber, eben wegen dieses Lärms, mich in den kleinen Garten an den Holztisch zurückzog, wo ich zu schreiben pflegte, fand ich wieder die Schwalben, die sich vom Jahrmarktstrubel nicht im geringsten stören ließen, dieselben Flüge vollführten, dieselben Laute von sich gaben. Eine Wiederholung schien wie die andere, alles war Wiederholung, die Laute, von denen man nicht loskam, bestanden aus Wiederholung, und obwohl es eine falsche Maske war, die der Hemdenverkäufer sich aufsetzte, obwohl er sich im Gespräch, das ich mit ihm hatte, als Jus-Student entpuppte, der sehr wohl wusste, was er wollte und sagte, machte mir doch sein konsequenter Gebrauch dieser Maske, in Verbindung mit den immergleichen, aber natürlichen Lauten der Schwalben einen solchen Eindruck, dass die Suche nach Redeweisen später, sobald ich wieder in Wien war, zu rastlosen nächtlichen Gängen durch die Straßen und Lokale der Leopoldstadt führte.
Schon am Ende dieses Jahres wurde mir das Revier zu eng. Ich begann mir längere Straßen, weitere Wege, andere Menschen zu wünschen. Wien war sehr groß, aber der Weg von der Aidgasse zur Ferdinandstraße war kurz, die Praterstraße, wo ich einige Monate mit meinem Bruder gewohnt hatte, schien erschöpft. Die Wege hier waren zur Routine geworden. In der Haidgasse erwartete ich Nacht für Nacht eine Katastrophe. Vielleicht hatte ich auch darum oft böse Gedanken und lief vor Vezas Fenster in die Ferdinandstraße, um mich am Licht in ihrem Zimmer zu beruhigen. Wenn es dunkel blieb und sie ausgegangen war, grollte ich ihr, obwohl sie mir?s angekündigt hatte. Etwas in mir schien zu erwarten, dass sie immer dazusein hatte, gleichgültig welche Verpflichtung sie hatte.
Allmählich erkannte ich, dass die Möglichkeit einer Kontrolle, die Nähe des Wegs zu ihr, die Versuchung, jeder Regung dieser Art nachzugeben, mein Misstrauen steigerte und zu einer Gefahr für uns wurde. Es musste eine Distanz zwischen uns geschaffen werden, ich musste aus der Haidgasse weg, und am besten wäre es, wenn ganz Wien zwischen uns läge, so dass jeder Weg zu ihr hin oder von ihr weg die Möglichkeit für mich böte, alle Gassen, Tore, Fenster, Lokale der Stadt kennenzulernen, ihre Stimmen alle zu hören, vor keiner zu erschrecken, mich ihnen auszuliefern, sie mir einzuverleiben und doch für immer neue offenzubleiben."
Das Ohr des Malers Arnulf Rainer
Wie fühlen Sie sich?
Unzufrieden. Sehr unzufrieden. Voller Ungenügen.
Womit? Wodurch?
Erstens einmal mit der Leistung dieses Tages. Zweitens, weil ich keinen neuen Schritt getan habe. Was ich mir vorgenommen hab, ist nicht gegangen. Entweder, weil ich mir etwas Falsches vorgenommen hab, oder weil ich das Richtige nicht hingekriegt hab.
Ich will aber nicht unbedingt nach einem schlechten Maltag dieses Interview beginnen.
Wir müssen es auch so versuchen. Es kann sich ja alles umdrehen! Es kann ja sein, daß ich plötzlich eine Erleuchtung krieg, daß ich da geschwind etwas höre und mitsinge. Verstehen Sie, ich bin da sehr erwartend. […]
Hören Sie manchmal Musik?
Nein. Ja. Selten. Aber das spielt keine große Rolle, denn ich hör eh immer etwas. Ich hör immer so ein Rauschen, so ein kosmisches Gesumme. Engelsummen und solche Sausesachen. Ich hör eh immer zuviel! Das würde mich nur irritieren, so irdische Schallplatten. Deshalb hab ich es am liebsten, wenn es ganz still ist. Ganz schweigend. Dann hört man die feinsten Dinge!
Brigitte Schwaiger und Arnulf Rainer, Malstunde, Reinbek bei Hamburg, 1984 [1980 Copyright by Paul Zsolny Verlag GmbH, Wien/Hamburg], S. 5 und 8.
Gewalt der Töne
"Die Frau, während die Äbtissin den Brief überlas, warf nunmehr einen Blick auf die nachlässig über dem Pult aufgeschlagene Partitur; und da sie, durch den Bericht des Tuchhändlers, auf den Gedanken gekommen war, es könne wohl die Gewalt der Töne gewesen sein, die, an jenem schauerlichen Tage, das Gemüt ihrer armen Söhne zerstört und verwirrt habe: so fragte sie die Klosterschwester, die hinter ihrem Stuhle stand, indem sie sich zu ihr umkehrte, schüchtern: »ob dies das Musikwerk wäre, das vor sechs Jahren, am Morgen jenes merkwürdigen Fronleichnamsfestes, in der Kathedrale aufgeführt worden sei?« Auf die Antwort der jungen Klosterschwester: ja! sie erinnere sich davon gehört zu haben, und es pflege seitdem, wenn man es nicht brauche, im Zimmer der hochwürdigsten Frau zu liegen: stand, lebhaft erschüttert, die Frau auf, und stellte sich, von mancherlei Gedanken durchkreuzt, vor den Pult. Sie betrachtete die unbekannten zauberischen Zeichen, womit sich ein fürchterlicher Geist geheimnisvoll den Kreis abzustecken schien, und meinte, in die Erde zu sinken, da sie grade das Gloria in excelsis aufgeschlagen fand. Es war ihr, als ob das ganze Schrecken der Tonkunst, das ihre Söhne verderbt hatte, über ihrem Haupte rauschend daherzöge; sie glaubte, bei dem bloßen Anblick ihre Sinne zu verlieren, und nachdem sie schnell, mit einer unendlichen Regung von Demut und Unterwerfung unter die göttliche Allmacht, das Blatt an ihre Lippen gedrückt hatte, setzte sie sich wieder auf ihren Stuhl zurück."
Aus: Heinrich von Kleist, Die heilige Cäcilie oder Die Gewalt der Musik
Leben, lauschen bleiben (Rilke)
Rainer Maria Rilke
An Heinrich von Kleists wintereinsamem Waldgrab in Wannsee
Wir sind keiner klarer oder blinder,
wir sind Alle Suchende, du weißt, –
und so wurdest du vielleicht der Finder,
ungeduldiger und dunkler Kleist
Eng und ängstlich waren dir die Tage
bis dein Weh den letzten wild zerriß –
und wir Alle klagten deine Klage,
und wir fühlten deine Finsternis.
Und wir standen oft an tiefen Teichen,
denen schon das Nachten nahe war,
und wir nahmen Abschied von den Eichen,
und wir kamen unsern Bräuten reichen
letzte Rosen aus dem letzten Jahr.
Aber zagend an dem Rand der Zeit
lernten wir die leisen Laute lieben,
und wir sind im Leben lauschen blieben
still und tief und wund von jungen Trieben –
und
da wurden uns die Wurzeln breit.
Vgl. den Kommentar "Leben und lauschen" von Hans-Ulrich Treichel (Frankfurter Anthologie, hrsg. von Marcel Reich-Ranicki, FAZ, Samstag 6. Juni 2009, Nr. 129, S. Z)
Ernst Jandls hörprobe
1
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
2
höhere hören
und daumen
höhere daumen
und hören
höhere hören
und höhere daumen
meine höheren daumen
meine höheren hören
3
kennen sie mich herren
kennen sie mich herren
kennen sie mich herren
meine damen und herren
Ernst Jandl, Sprechblasen, Stuttgart 1984: Reclam 1984, S. 31.
Gottes Ohr
"Sie haben die Mutter Kirche verlassen, Herr Taads?" fragte der Kammerherr.
Arnold Taads starrte ihn an und entgegnete schließlich: "Eine Diskussion darüber sollten wir lieber vermeiden. Was ich dazu zu sagen habe, würde ihnen überaus unhöflich im Ohr klingen."
"Ich habe auch nur Menschenohren. Gottes Ohren sind es, die Sie beleidigen könnten."
Taads sagte nichts. Inni versuchte, sich das vorzustellen: Gottes Ohren. Wer weiß, vielleicht war Gott ganz Ohr, ein Riesenohr aus Marmor, das durch den Weltraum schwebt. Aber Gott gab es nicht. Den Papst allerdings, das stand fest, und von dem war dieser seltene Vogel hier der Kammerherr, der Geheime Kammerherr. Aber was war das eigentlich? Wenn er selbst geheim wäre, würde das niemand wissen. Dann war er vielleicht Herr der geheimen Kammer. Das geheimen Kammer im Vatikan, wo sich die weiße, ebenso vogelartige Gestalt Pius XII. aufhielt und zu der dieser Mann hier Zutritt hatte: weißer Reiher und bunte Krähe. Was würden sie da beraten? Geheimnisvolles Flüstern auf Italienisch, aber worüber? Vielleicht war er der Beichtvater des Papstes. Konnte ein Papst eigentlich noch sündigen? Er erinnerte sich seiner eigenen Beichtsitzungen in zahllosen säuerlich riechenden Beichtstühlen, des geflüsterten Wortwechsels, des gräßlichen Mannergeruchs, in dem Wörter wie Unkeuschheit, Reue und Vergebung dahinschwebten, seiner eigenen Stimme in der ekelerregenden Intimität der hölzernen Sitzfläche.
Cees Nooteboom, Rituale, aus dem Niederländischen von Hans Herrfurth, Frankfurt a.M., 1998, S. 103 f.